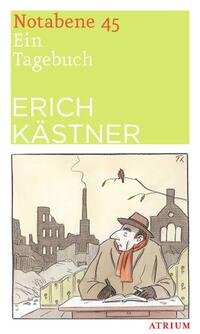Vor 80 Jahren im April.
Eine auszugsweise Betrachtung von „Notabene 45. Ein Tagebuch von Erich Kästner“
„Die Welt ist rund. Man geht auf Reisen, damit sich die Nervosität verliert.“
Erich Kästner
Erich Kästner tut es: Am 7. Februar 1945, sechs Tage vor dem verheerenden Bombenangriff auf seine Geburtsstadt Dresden, verlässt er Berlin-Charlottenburg und zieht mit einer Gruppe von Leuten in die Berge. Seine Aufzeichnungen beginnen an diesem Tag und reichen bis zum 2. August (ergänzt um ein Postskriptum aus 1960). Ein Monat lang, im April, begleiten wir ihn. Was wir wissen, verdanken wir zierlichsten stenographischen Zeichen in einem Blindband mit blauem Umschlag – „aufs Sichtbarste verborgen“ inmitten von Büchern.
Später wird das so genannte „Blaue Buch“ literarisch verarbeitet und schließlich 1961 als „Notabene 54. Ein Tagebuch von Erich Kästner“ verlegt.
Mit ihm sind einige andere Filmleute im Zillertal. Dort, wo die Welt noch in Ordnung ist und wo die Kühe froh muhen: „Die Natur ist weise, und Milch, Butter und Käse sind vorzüglich“. In den als bombensicher geltenden Winkel Mayrhofen reist schließlich auch Kästners Freundin Lotte von Innsbruck aus nach. Was sie vorhaben, gleicht einem Schelmenstreich. Sie geben an, als Filmleute einen Film drehen zu wollen („Das verlorene Gesicht“).
Dem Propagandaministerium macht man weis es handle sich um einen Propagandafilm für den Endsieg. Der UFA-Produzent Eberhard Schmidt deklariert den (mit Pseudonym reisenden) Kästner zum Drehbuchautor, begleitet von einer 60-köpfigen Crew. Und tatsächlich inszeniert man dort Drehtage, an denen surrende Kameras, glänzende Silberblenden, ein geschäftiger Regisseur, Dutzende agierende Schauspielleute sowie sich tummelnde Aufnahmeleiter der Dorfbevölkerung die große Welt des Films vorgaukeln. Maske und Kostüme lassen die Dorfjugend mit offenem Mund dastehen.
In Kästners Aufzeichnungen am 19. April heißt es: „Wie erstaunt wären sie gewesen, wenn sie gewusst hätten, daß die Filmkassette der Kamera leer war! Rohfilm ist kostbar. Bluff genügt. Der Titel des Meisterwerks, „Das verlorene Gesicht“, ist noch hintergründiger, als ich dachte.“
Worum geht´s wirklich abseits dieser Komödie?
Um Rückzug und Durchatmen: Seit Kästner, vom NS-Regime mit einem Schreibverbot belegt, muss 1933 den Rauch seiner auf dem Scheiterhaufen verbrannten Bücher einatmen – ihm bleibt die Luft weg. Mehrfache Gestapo-Verhöre nimmt er besonnen wahr. Hier ist er ein andrer, arbeitet und lebt unter einem Pseudonym und zeigt weder im Leben noch in seinen Aufzeichnungen Verbitterung oder Larmoyanz. Sein demaskierender Sarkasmus und die schonungslos-neutrale Schilderung von Untaten (etwa der alliierten Truppen in der Endphase des Krieges) bieten ein wertfreies Zeitzeugnis.
Skurril nimmt sich die ironische Darstellung einer bis zuletzt maschinenartig arbeitenden Bürokratie aus, die Formblätter immer noch achtfach ausgefertigt verlangt. Mit der gleichen humorverbrämten Akribie schildert er die Tiroler Spießer und ihre spöttische (aber infolge der Verdienstmöglichkeiten klug kaschierte) Verachtung für die großstädtischen „Preußen“.
Die Dörfler einerseits, die Städter auf der anderen Seite: hier und dort geht es um bemühte Harmonie, Durchhalteparolen und überlebensschlaue Wendehälse; hier und dort greifen – auf Augenhöhe mit dem, was ist –Kästners sinnige Betrachtungen über Untertanenhaltung, Politikanalyse und Zukunftsschau.
Da diese Buchbesprechung in den Monat „April“ fällt, sei an dieser Stelle an den April vor 80 Jahren erinnert, den Kästner in Mayrhofen verbringt, wie schon den Februar und März davor und den Mai und den halben Juni danach. Dann geht’s weiter nach „P.“ in Bayern, zurück nach Mayrhofen und schließlich an den Schliersee.
Damals geschieht in der Welt Folgendes: Der Monat beginnt mit dem Einrücken der Roten Armee in Österreich (NS-Gauleiter Baldur von Schirach erklärt Wien zur Festung). Konzentrationslager (etwa Vaihingen) werden schon durch die Franzosen befreit, während in Flossenbürg (Oberpfalz) noch die inhaftierten Dietrich Bonhoeffer und Wilhelm Canaris hingerichtet werden. Amerikanische Einheiten befreien das KZ Buchenwald. Der jugoslawische Ministerpräsident Tito unterschreibt einen Freundschaftsvertrag mit der Sowjetunion. Um die Monatsmitte schließt die Rote Armee die Eroberung von Wien ab.
Es werden 50.000 Häftlinge aus den KZ Ravensbrück und Sachsenhausen von der SS zu einem Todesmarsch nach Westen gezwungen. Währenddessen gelingt sowjetischen Einheiten der Durchbruch durch die deutsche Verteidigungslinie an der Oder. Im eingekesselten Ruhrgebiet ergeben sich die letzten Wehrmachtstruppen; dort gehen 320.000 Soldaten in Kriegsgefangenschaft.
Die Amerikaner erobern Bologna. Die Rote Armee dringt in das Stadtgebiet von Berlin ein und damit beginnt das letzte Drittel: die Ereignisse kulminieren. Hitler entlässt Reichsmarschall Hermann Göring (dieser hatte als Vertreter des Deutschen Reichs Verhandlungen mit den Westalliierten über eine Verständigung führen wollen) aus allen Staats- und Parteiämtern. Das NS-Parteiorgan „Völkischer Beobachter“ stellt sein Erscheinen ein. Bei Torgau an der Elbe treffen sich erstmals sowjetische und amerikanische Einheiten in Deutschland.
In Mailand scheitern Benito Mussolinis Verhandlungen mit Partisanenführern über eine Machtübergabe, er versucht, nach Deutschland zu fliehen, wird aber wenig später am Comer See gefasst und erschossen. Eisenhower weist die amerikanischen Truppen an, Deutschland als besetztes Land zu betrachten.
Karl Renner bildet in Wien eine provisorische österreichische Regierung. Generaloberst Nikolai E. Bersarin wird zum ersten sowjetischen Stadtkommandanten von Berlin ernannt. Und nun: Am 29.4. heiratet Hitler Eva Braun und schreibt sein Testament.
Interessant ist Kästners Reflexion über den Rundfunk, der erstaunlicherweise immer noch Informationen (wenngleich mehr Propaganda als „echte“ Nachrichten) bietet. An dem Tag schreibt er: „29. April 1945. Heute über Tag war der Münchner Sender stundenlang still. Es war, als sende er Schweigen. Abends, zehn Uhr … rührte er sich plötzlich wieder. Und was brachte er? ‚Heiße‘ Musik. Erst unkommentierte Funkstille, dann undeutschen Jazz ohne Worte, was ist geschehen? (…) Liebt der Nachtportier amerikanische Platten?“ Tags darauf begeht Hitler Selbstmord im Führerbunker.
Was wir in „Notabene 45“ lesen mutet – so sagt die deutsche Kriminalschriftstellerin, Literaturübersetzerin und Journalistin. Pieke Biermann – an, wie „Augenzeugenmaterial zur Historiografie über NS-Deutschland, den (Luft-)Krieg, das Ende… um wenige wichtige Weltdaten ergänzt“. Das skurrile an “Notabene 45“ aber ist, dass sich die sarkastisch und messerscharf dargestellten Weltgeschehnisse mit der Schilderung der Landidylle mischen. So heißt es etwa am 9. April, von dem Kästner notiert, dass die Amerikaner vom Rhein her Bremen anzusteuern scheinen: „Es gibt noch Küchen mit offenen Feuerstellen und das Rauchfleisch und der Speck hängen dutzendweise an der Decke.“ Oder am 17. April: „Der Patriarch sitzt täglich etliche Stunden im idyllisch gelegenen Waldcafé, hat eine auffällige altmodische Kladde vor sich liegen und rechnet.“ Und all das, während in Berlin die Rote Armee die Oberhand erringt und Kästner an diesem Tag auch berichtet: „Die fragile Wespentaille zwischen Nord- und Süddeutschland wird von zwei kräftigen Händen umspannt, einer amerikanischen Hand und einer russischen [sic; recte: einer sowjetischen]. Die Engländer marschieren auf Hamburg. Bremen wird belagert […] in Halle an der Saale wird gekämpft, Panzerspitzen nähern sich Chemnitz, Wien scheint gefallen zu sein“.
80 Jahre sind vergangen, seit all das geschehen ist. Kästner hat später einige Notizen zum August 1945 nachgetragen. Eine davon lässt mich mit Blick auf das gegenwärtige Weltgeschehen erschaudern: „Wir stecken hilflos fest, wie Nägel in einer Wand. Wer wird uns herausziehen und wann?“
Erich Kästner: Notabene 45 – Ein Tagebuch
Atrium Verlag, Zürich 2012
ISBN-13978-3-85535-386-6 bzw. ISBN-10: 3855353867