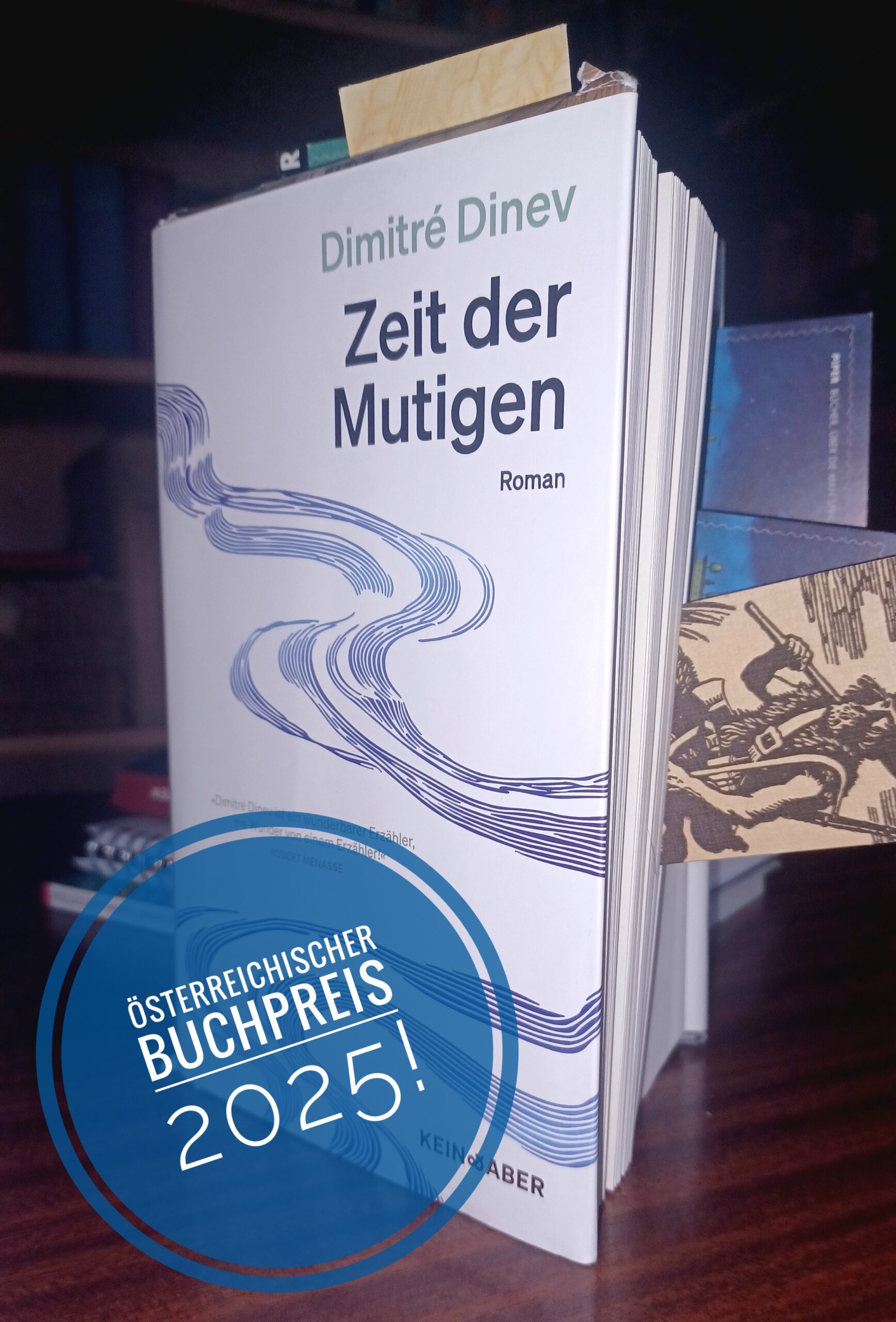Maria Lehner: Ein Erzähl-Fluss, mäandernd aus Tinte, Blut und Donauwasser.
Dimitré Dinevs „Zeit der Mutigen“
Seit seinem Erscheinen im September 2025 habe ich immer wieder an diesem Roman gelesen. Verschwenderische drei Durchgänge habe ich mir gegönnt. Warum auch nicht? Der Autor hat 13 Jahre daran geschrieben… Dinev ist ein großer Erzähler, der mitreißt.
Er ist aber auch ein raffinierter Gestalter, der denen, die Strukturen und Details entdecken möchten, am laufenden Band Überraschungen bietet. Über den Roman heißt es die Zeit der Mutigen sei eine, in der man überall und bei Tag und Nacht mutig sein musste. Mut erforderte auch Dinevs Vorhaben, ein solches Monumentalwerk zu schaffen.
Der 1968 in Plowdiw Geborene floh 1990, drei Jahre nach der Reifeprüfung, über die Grüne Grenze nach Österreich, wo er sich die folgenden Jahre mit Gelegenheitsjobs durchbrachte. Ich entdeckte ihn vor zwanzig Jahren, als ich „Engelszungen“ (erschienen 2003) las, eine Familiensaga, die den Bogen über mehrere Jahrzehnte der Shivkov-Ära in Bulgarien spannt.
In „Zeit der Mutigen“ ist es eine Vielzahl von Figuren, die sich knapp aneinander vorbei bewegen. Über Generationen hinweg sind Menschen miteinander verwoben. Kriege und Gesinnungsdiktatur bestimmen individuelle Schicksale im Zeitenlauf (vom Ersten Weltkrieg über den Faschismus und das kommunistische Regime in Bulgarien bis in die schnell verebbende Euphorie der 1990er-Jahre). Die Donau dient dabei als zentrales Symbol und als Schauplatz – ein Fluss, der Österreich und Bulgarien verbindet und der Dinevs „Identitätsströme“ kanalisiert: Die Donau wird zur literarischen Metapher für Fließen, Erinnern und Übergang.
Die Erzählung mäandert wie der Fluss selbst – nicht bloß linear, sondern organisch und vielschichtig, was das Lesen zur Konzentrationsübung macht. Der Fluss ist genauso Verbündeter und Zuhörer wie auch Zerstörer und Retter. Und immer wieder sind es Mut, Zufall und der gefundene Ausweg in aussichtslos scheinender Situation, die den Titel rechtfertigen.
Wenn das Wort „Text“ seinem Ursprung nach „Gewebe“ bedeutet, dann ist leicht zu sagen, was der Roman nicht ist: eine Anordnung abwechselnd übereinander gelegter und regelmäßig miteinander verkreuzter Kett- und Schussfäden. Vielmehr erwarten uns feine Bindungen und komplexe Musterungen, deren Details erst aus einer gewissen Distanz oder einem speziellen Lichteinfall sichtbar werden. Er selbst beschreibt im Roman einen kunstvollen Teppich, in dem bei fortwährender Betrachtung immer mehr Details entstehen – für das Buch gilt das auch.
Der Roman beginnt mit einem Offizier der k.u.k. Armee, Alois Kozusnik, der am Vorabend des Ersten Weltkriegs das Dienstmädchen Eva Nagel in den Donauauen rettet – ein klarer Verweis auf das Habsburgerreich und die österreichische Geschichte vor dem Ersten Weltkrieg. Diese Szene ist nicht nur geografisch in Österreich verortet, sondern auch kulturell tief verwurzelt in der österreichischen Literaturtradition – sie erinnert stilistisch an Ödön von Horváth. Die Begegnung setzt eine Kette von Ereignissen in Gang, die sich über Generationen hinweg auswirkt und die ungeahnte und mitunter von den Akteuren ungeahnte Wiederbegegnungen ermöglicht. Die so weit voneinander entfernten Schicksale greifen dermaßen ineinander, dass auch ein zweiter Lesevorgang zum Denkspiel wird. Im zweiten Erzählstrang hören wir mit den namenlosen Insassen des Straflagers die kollektiven Stimmen der Unterdrückten.
Hiezu hat Dinev mit Hilfe des Journalisten Hristo Hristov, Autor u.a. des Werks „Geheimakten über die Lager“ (1999), umfassend recherchiert. Die Figuren stehen für die Generationen, die unter totalitären Regimen litten – Orte der Hölle auf Erden. Dinev legt mit der Schilderung der Geschehnisse im kommunistischen Regime in Bulgarien eine schonungslose Abrechnung vor. Der dritte Erzählstrang thematisiert das Leben der „Erben der Geschichte“, der Menschen der Gegenwart, die mit den Schatten der Vergangenheit leben. Diese Figuren sind oft Nachkommen oder indirekt Verbundene der früheren Protagonisten.
Sie stellen die Frage: Wie lebt man weiter, wenn die Geschichte in einem fortwirkt?
Wie übersteht man Jahre der Gewalt und Unterdrückung?
Wie gelingt es, Hoffnung, Liebe und Würde zu bewahren?
Dinev zeigt, wie sich die Vergangenheit in die Gegenwart einschreibt – in Körper, Sprache und Erinnerung. Insgesamt sind diese Menschen (und für jeden gibt es einen eigenen Erzählrhythmus) ein Spiegel Europas, keine bloßen Individuen, sondern Träger kollektiver Erfahrungen. In ihnen reflektieren sich politische Systeme und Verkörperungen menschlicher Sehnsucht.
Das zur groben Navigation hilfreiche Personeninventar rund um die Kernfigur Meto befindet sich auf der allerletzten Buchseite. Es ist, als würde Dinev die Geschichte Europas durch ihn erzählen.
Die sieben Kapitel – Wasser, Feuer, Steine, Wolken, Wind, Erde, Sonne – bilden einen symbolischen Kreislauf von Geburt über Zerstörung, Erinnerung, Sehnsucht, Bewegung, Herkunft bis zur Erleuchtung.
Von besonderem Interesse sind die autobiografischen Elemente, die Dinevs Erfahrungen mit dem Leben in Wien und der österreichischen Gesellschaft reflektieren. Als Bauarbeiter, Gärtner, Kellner, Casino-Mitarbeiter, Würstelverkäufer, Übersetzer, Restaurator und Vergolder arbeitete er zehn Stunden am Tag, um – seit 1991 – nachts zu schreiben. Später studiert er Philosophie und russische Philologie.
Die Geschichte der heutigen Staaten Österreich und Bulgarien – im Großen wie im Kleinen – entfaltet sich detailreich: etwa die Geschichte des 1944 errichteten Arbeitslagers Belene, das Bildungs- und Sozialgefälle in Städten und Dörfern, der Umgang mit dem fahrenden Volk, das System des Geheimdiensts; wir tauchen ein in ein Konglomerat aus Volksglauben und Aufklärung.
Aber auch Geschichtssplitter aus Österreich – von Nazischergen bis Kreiskys Tod und von der Ermordung des Stadtrat Nittel bis zum Weinskandal – machen den Roman zum literarischen Monument. Das Pendel schwingt zwischen Menschenverachtung und Humanismus, zwischen Gräueltaten und Empathie. Und wir finden uns dank eingängiger Schilderungen immer umgeben von vorstellbaren Bildern – sei es in den entlegenen Behausungen der bulgarischen Dörfer, in den Häuserzeilen von Plovdiv, auf einem Luxusdampfer oder beim Gulasch im Wiener Café Hummel. Wien erscheint im Übrigen nicht als romantisierte Kulisse, sondern als Ort der existenziellen Prüfung.
Auf der Seite 1148 schließt sich der Kreis zum Anfangszitat („Das Wunder der Schöpfung besteht darin, dass ein moralisches Wesen geschaffen wird“) des französischen Philosophen und Autors
Emmanuel Lévinas. Wieder taucht eine Figur namens „Eva“, die Urenkelin der Eva Nagel, auf. Diese Eva beobachtet in der Jetztzeit ein Kind, das am Ufer der Donau mit Gräsern und Rinde hantiert:
„Was bastelst du da?“, fragte sie.
„Einen Menschen.“
„Gibt es denn nicht genug davon?“
„Einen Freund kann man immer brauchen. Willst du mitmachen?“
Einen wirkungsvolleren Schluss kann ich mir kaum denken für einen Roman, der die Fähigkeit würdigt, Menschlichkeit zu bewahren, Mut und Widerständigkeit zu leben – selbst und gerade eben unter Bedingungen, die sie zu ersticken drohen.
Der unabhängige Zürcher Autorenverlag Kein & Aber, in dem sich seit 1997 über 180 Erzählerinnen und Erzähler versammeln, schlägt mit diesem Buch – wie er es sich in seiner Selbstbeschreibung zum Ziel setzt – „kühn und hartnäckig eine Schneise ins Dickicht der literarischen Fantasien“: Ich spreche eine absolute Leseempfehlung aus!
Dimitré Dinev: Zeit der Mutigen. Roman. Zürich: Kein & Aber, September 2025, 1. Auflage. Hardcover, 1152 Seiten. € 37,10. ISBN: 978-3-0369-5079-2. Auch erhältlich als E-Book (epub) 949 Seiten. € 24