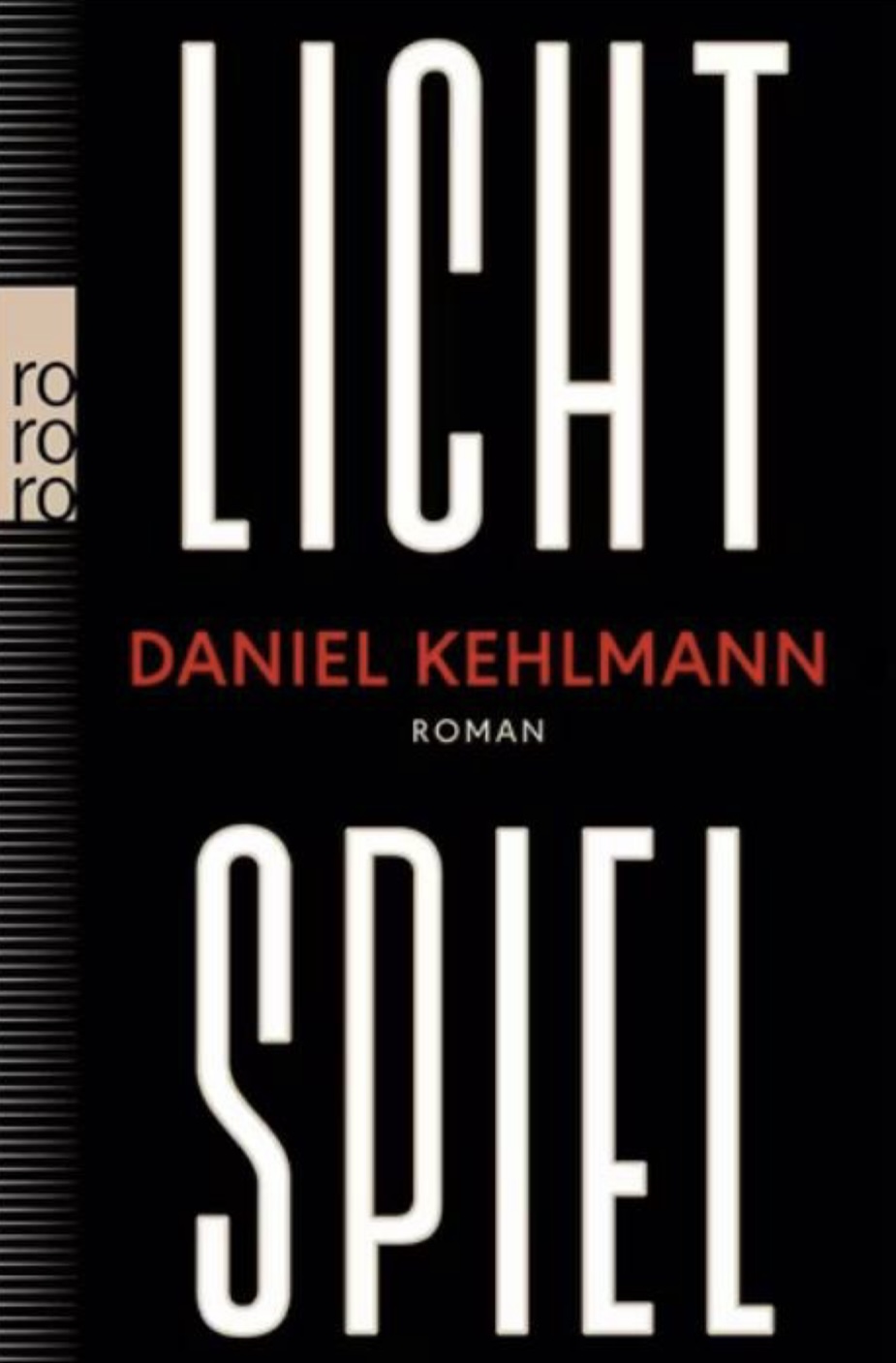Das Licht der Kunst im Schatten der Diktatur.:
Daniel Kehlmanns Roman „Lichtspiel“
„Wichtig ist, Kunst zu machen, unter den Umständen, die man vorfindet“, das ist wohl die Hauptaussage aus Daniel Kehlmanns Roman. Protagonist ist der berühmte österreichische Filmregisseur Regisseur G.W. Pabst (1885-1967). Wir begegnen ihm in der Zwischenkriegszeit in Deutschland und später in Hollywood, wohin er nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten flieht. Dort macht er u.a. mit Greta Garbo und Louise Brooks Filme. Es scheint aber künstlerische Differenzen zu geben. Als er 1939 die Nachricht erhält, dass seine im steirischen Tillmitsch lebende Mutter sehr krank ist, plant er einen kurzen Stopp in der „Ostmark“ – und findet sich im Krieg wieder. Im NS-Staat wird er von Propagandaminister Joseph Goebbels bedrängt, Filme für das Regime zu drehen. Er gerät in ein Netz aus Verführung, Einschüchterung und Opportunismus. Wie „macht“ man unter solchen Umständen Kunst? Und: welche Art von Kunst? Gelingt die Einschätzung, wie viel Kompromiss zu viel ist? Besteht die Kunst darin, sich als Künstler in einem totalitären System zu behaupten?
Daniel Kehlmann, geboren acht Jahre nach dem Tod von Pabst, erzählt über den Filmemacher mit den Mitteln des Films: Er lässt Perspektiven rasant wechseln und erschafft temporeiche Szenen. Kehlmann nutzt bewusst filmische Mittel wie „Schnitt“, „Blende“, „Kamera läuft“ als Kapitelüberschriften oder Übergänge. Es ist, als lese man einen Film, nicht einen Roman. Historische Fakten und Erfundenes verschmelzen zur Handlung – es ist ein Spiel: Was ist dokumentiert, was ist interpretiert? Im „Abspann“ (des Romans) versteckt sich das – beim Lesen oftmals überblätterte – Kapitel „Dank“: es gebe zwar den Sohn Jakob nicht, doch der „verlorene Film“ (eine zur Erzählung ausgebaute Metapher, die den Rahmen um die ganze Geschichte bildet) sei tatsächlich verschollen. Diese eine Tatsache nennt er, doch wie oft und wo hat uns der Autor gekonnt „verführt“, das was wir sehen, für „Wirklichkeit“ zu halten?
Solchermaßen wird Lesen zum Mitdenken, nicht nur zum Beobachten. Und wie auch schon in anderen Romanen gerät der Autor nicht ins Belehren und Herausfordern, sondern unterhält. Da verfließt Raffinesse mit einem Hauch Ironie.
Mich hat besonders der Aufbau der Handlungsstruktur fasziniert. Er wird in Form von Ortsadverbien und Temporaladverbien gestaltet:
Es beginnt mit „Jetzt“ – da erzählt ein alternder ehemaliger Kameraassistenz Franz Wilzek von seiner Zusammenarbeit mit Pabst.
„Draußen“ bezieht sich auf die Zeit, die Pabst als emigrierter Filmemacher in Hollywood verbringt. „Drinnen“ ist er, als er nach Österreich zurückkehrt, das inzwischen ans Dritte Reich angeschlossen ist. Pabst soll Filme wie „Komödianten“ zu drehen – motiviert durch die subtile Drohung: „Bedenken Sie, was ich Ihnen bieten kann, zum Beispiel KZ. Jederzeit.“
„Danach“, in der Nachkriegszeit, versucht Pabst, sich von seiner Vergangenheit zu distanzieren. Doch die Vergangenheit ist ein Schatten, der sich nicht abschütteln oder sich nicht einfach „wegschneiden“ lässt wie eine Filmszene.
Am Schluss beendet in einem zweiten „Jetzt“ der Kameraassistent die Geschichte.
Daniel Kehlmanns Roman ist eine tiefgründige Auseinandersetzung mit Kunst, Opportunismus und moralischer Ambivalenz im NS-Staat. Der Protagonist hat während seiner Zeit im nationalsozialistischen Deutschland mehrere Filme gedreht, wobei er sich bewusst für historische Stoffe entschieden hat, um sich von direkter Propaganda zu distanzieren. Aber: Gab es im NS-Staat einen völlig unpolitischen Film? Das 1943 entstandene biografische Drama über den Arzt und Philosophen Theophrastus Bombast von Hohenheim (genannt „Paracelsus“) mit Werner Krauss in der Hauptrolle ist ideologisch aufgeladen und wird durch die NS-Führung ideologisch verwertet als inszenierter „deutscher Geist“. Es wird sichtbar, wie vehement Pabst das (übrigens auch bezogen auf den Film „Komödianten“) verdrängt.
Als jemand, der lernen will, beobachtet man: Mir welchen Mitteln gelingt dem Autor die Annäherung an Pabst? Kehlmann bewegt sich zwischen Fakten und Fiktion: Er nutzt historische Quellen, ergänzt sie aber mit erfundenen Dialogen und Szenen, die die innere Zerrissenheit Pabsts greifbar machen. Er wechselt die Erzählperspektiven und skizziert moralische Grauzonen: Pabst ist bei Kehlmann weder Held noch Täter, sondern Künstler, dem es schwerfällt, in einer Diktatur „neutral“ zu bleiben. In einzelnen Textstellen charakterisiert Kehlmann seinen Protagonisten: „Er war kein Held. Aber auch kein Verräter. Vielleicht war er einfach nur ein Mann, der zu lange gehofft hatte, dass alles gut ausgehen würde.“ Er bleibt ein Rätsel, dieser G.W. Pabst: Prinzipien hat er – aber keinen Heldenmut; politisch ist er – aber auch nicht naiv, indem er die Gefahr erkennt und sich ihr entziehen will. Wenn er bleibt, dann hat er gute Gründe: Angst, familiäre Bindung, Hoffnung auf die Möglichkeit zu eigener Kontrolle und Einflussnahme. Uns begegnet ein Mann, der sich selbst als Opfer der Umstände sieht. Das macht ihn nicht unschuldig, aber menschlich.
Offen bleibt die Frage, wie Kunst in einem repressiven System funktioniert und ob Kunst überhaupt „unpolitisch“ sein kann bzw. wie viel Verantwortung ein Künstler für das trägt, was er nicht sagt. So gesehen ist „Lichtspiel“ nicht nur ein zeitloser Roman, sondern er lädt uns geradezu ein, hinzuschauen, wenn es heute um Ai Weiwei, Jafar Panahi, Kirill Serebrennikow… oder ganz einfach um „Auftragskunst“ geht. „Lichtspiel“ öffnet Denkräume!
Daniel Kehlmann: Lichtspiel. Roman. Hamburg: Rowohlt, 20234. 483 Seiten.
ISBN 9783498003876. Hardcover 27.90 €; Taschenbuch 17.20 €; E-BOOK (EPUB) 14.99 €;
Audio 31.80 € · Hörbuch (mp3) 24.00 €